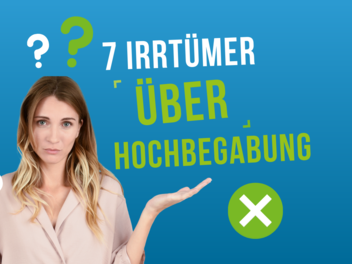Hochbegabung erkennen und fördern

Jeder Mensch verfügt bei seiner Geburt über Veranlagungen, bestimmte Dinge gut, andere wiederum nicht so gut ausführen zu können.
Anstelle von Anlagen spricht man auch häufig von den Begabungen eines Menschen. Dabei kann ein Mensch in ganz unterschiedlichen Bereichen über Begabungen verfügen: im Sport, in der Musik, in den sozialen Fähigkeiten oder auch in Mathematik, Sprachen oder Naturwissenschaften.
Eine besondere Begabung in einem bestimmten Bereich ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für besondere Leistungen in diesem Bereich. Eine besondere psychomotorische Begabung zum Beispiel befähigt den Menschen in bestimmten Sportarten zu herausragenden Leistungen. Ob er aber diese Leistungen auch tatsächlich zeigt, hängt von weiteren Faktoren im Menschen selber und seiner Umwelt ab: Anstrengungsbereitschaft, Verfügbarkeit von Lern- und Arbeitstechniken, psychischer Stabilität, Förderung durch die Umwelt, usw.
Im sogenannten Münchner Hochbegabungsmodell wird dieses anschaulich dargestellt.
Das Ziel jeder Pädagogik muss es nun sein, die Rahmenbedingungen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um ihre Begabungen in den verschiedenen Bereichen zu entdecken, zu entfalten und selbstverantwortlich für sich und die Gesellschaft einzubringen.

CJD-Schwerpunkte zur Förderung hochbegabter Menschen
- Diagnostik und Beratung
- Frühe Förderung
- Intellektuelle Förderung
- Leistungssportförderung
- Musische Förderung (künstlerisch, musikalisch)
Wenn Sie mehr über die Hochbegabtenförderung im CJD wissen möchten oder wenn Sie das CJD in der Förderung von hochbegabten Kindern unterstützen möchten, melden Sie sich gerne bei uns – wir informieren Sie.
Unser Angebot im Detail
Beratung, Diagnostik und Förderung für junge Menschen
Das Institut für Hochbegabtenförderung ist die gemeinsame Plattform der CJD Einrichtungen, die Beratung, Diagnostik und/oder Förderung für junge Menschen anbieten.
Unser Ziel ist es, eine vorurteilsfreie Diskussion über Hochbegabung und Hochbegabtenförderung zu ermöglichen und mitzugestalten.
Zu den Aufgaben des Instituts und der daran beteiligten Einrichtungen gehört sowohl die Etablierung diagnostischer Standards als auch die Bereitstellung praktisch erprobter Bausteine zur Förderung hochbegabter Jungen und Mädchen in Deutschland.
Das Institut steht allen interessierten Einrichtungen und Personen innerhalb und außerhalb des CJD in Fragen der Diagnostik, Beratung und Fortbildung zur Verfügung.
Welche Angebote hält das CJD bereit?
- In den begabungspsychologischen Beratungsstellen des CJD wird professionell und verantwortlich die intellektuelle Begabungsstruktur von Kindern und Jugendlichen diagnostiziert und eine unabhängige Beratung angeboten (Diagnostik und Beratung).
- In Christophorusschulen und anderen Einrichtungen des CJD (Übersicht) ist in Sonderprogrammen oder in integrativen Programmen für sehr begabte oder hochbegabte SchülerInnen Förderung und Forderung institutionalisiert. In allen diesen Schulen ist die Förderung der jeweiligen Hochbegabung durch ganzheitliche Bildung und Erziehung auf die ganze Person gerichtet.
- Für hochbegabte SchülerInnen mit besonderen Problemen, z.B. mit Essstörungen oder sog. Minderleister (Underachiever), werden gemeinsam mit den Psychologischen Diensten der CJD Einrichtungen besondere Hilfestellungen geschaffen.
CJD Einrichtungen mit Diagnostik- und Beratungsangebot:
- CJD Jugenddorf-Christophorusschule Braunschweig
- CJD Dortmund
- CJD Christophorusschule Droyßig
- CJD Göddenstedt
- CJD Hannover
- CJD Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter
- CJD Jugenddorf Nürnberg
- CJD Christophorusschule Rostock
Aufgaben der Beratungsstellen
In ausgewählten Beratungsstellen findet deutschlandweit eine differenzierte Begabungsdiagnostik statt. Diese berücksichtigt neben der Diagnostik intellektueller Fähigkeiten auch die Erfassung weiterer für den schulischen und beruflichen Erfolg notwendiger Begabungsfaktoren (z. B. Anstrengungsbereitschaft, Konzentrationsvermögen, emotionale Stabilität).
Auf der Grundlage einer umfangreichen Anamnese und Diagnostik wird im Anschluss eine auf die spezifische Situation zugeschnittene Beratung der Betroffenen durchgeführt. Ebenfalls inbegriffen ist ein zusammenfassendes, schriftliches Gutachten.
Die Beratungsstellen kooperieren eng miteinander und verfügen über einheitliche diagnostische Instrumente und vergleichbare Beratungsstandards, sodass eine hohe Qualität in der Arbeit aufrechterhalten werden kann. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Verfahren können auf diese Weise in die Arbeit schnell einbezogen und umgesetzt werden.
Im Rahmen der Beratungsstellen können u. a. folgende Fragestellung oder Aufträge beantwortet werden:
- Erstellen eines differenzierten Begabungsprofils von Kindern und Jugendlichen,
- Klärung von Über- und Unterforderung eines Schülers in der aktuellen Situation, Notwendigkeit spezieller Fördermaßnahmen wie das vorzeitige Einschulen, Klassenüberspringen oder das Wahrnehmen außerschulischer Angebote,
- Beratung der Eltern, Lehrer und des Schülers auf der Grundlage einer ausführlichen Diagnostik,
- Beratung von Eltern, Lehrern und Schülern über das Thema (Hoch-)Begabung und Fördermöglichkeiten.
Zudem bieten einige der Beratungsstellen noch weitere Angebote an, die jeweils vor Ort zu erfragen sind.
Grundsatz aller Beratungsstellen ist es, den ganzen Menschen mit seinen verschiedenen Begabungen, seiner psychischen Ausstattung, seinen Erfahrungen und den aktuellen Umweltfaktoren zu berücksichtigen und nicht nur den Intelligenzquotienten des Kindes oder Jugendlichen als ausschlaggebend zu betrachten. Denn nur so gelingt es, eine individuelle, auf die Bedürfnisse des Kindes / Jugendlichen zugeschnittene Beratung anzubieten.
Da die Intelligenz eines Menschen im Vor- und Grundschulalter noch eine sehr sprunghafte Entwicklung zeigt, haben sich die Psychologen im CJD darauf verständigt, in diesem Alter noch nicht von einer feststehenden Hochbegabung auszugehen, sondern bei entsprechend hohen Werten erst einmal von einem Entwicklungsvorsprung zu sprechen. Dieser zurückhaltende Ansatz bezüglich der Diagnostik berücksichtigt Erkenntnisse über Diagnoseverfahren, langjährige Erfahrungen mit frühen Hochbegabungsdiagnosen und intellektuellen Entwicklungsverläufen.
Genauere Ausführungen zum Begabungsbegriff und der Bedeutung von Intelligenztests finden Sie unter „Intellektuelle Förderung“.
Jedes Kind hat ein Grundrecht auf Förderung nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen.
Hochbegabte Kinder sind Gleichaltrigen oft schon in den ersten Lebensjahren in ihrer kognitiven Entwicklung weit voraus. Schon früh können sie durch ausgeprägtes logisches und analytisches Denken, extreme Merkfähigkeit oder durch überlegenes Sprechvermögen auffallen. Bisweilen erlernen sie im Kindergartenalter Kulturtechniken völlig selbständig.
Hochbegabung kann aber auch in diesem Alter bereits Probleme verursachen. Hochbegabte Kinder denken und handeln anders. Die Umwelt reagiert bisweilen mit Unverständnis. Zudem ist ein hohes intellektuelles Potenzial noch kein Garant für hohe Leistungsfähigkeit oder für das Erbringen einer für das Individuum lustvollen und für die Gesellschaft wertvollen Leistung. Erforderlich dazu ist stets auch das Erlernen von Arbeitshaltungen, wie z. B. Anstrengungsbereitschaft und Durchhaltevermögen. Die langjährigen Erfahrungen im CJD zeigen, dass wir mit der Förderung unserer hochbegabten Kinder möglichst früh beginnen müssen.
Deshalb brauchen besonders begabte Kinder bereits in der Kindertagesstätte eine Förderung, die Motivation schafft, Unterforderung vermeidet und den Grundstein legt zum Erwerb der für den individuellen Bildungsweg erforderlichen Arbeitshaltungen, um spätere Probleme wie z. B. Minderleistung zu vermeiden.
Förderung Hochbegabter ist in den Kindertagesstätten des CJD nie ausschließlich Förderung der kognitiven Entwicklung, sondern bezieht sich immer auf die gesamte Persönlichkeit. Deshalb arbeiten wir grundsätzlich sozialintegrativ, d. h. hochbegabte Kinder und Kinder aus den umliegenden Stadtteilen sowie behinderte Kinder spielen und lernen bei uns gemeinsam. Hochbegabte Kinder haben hier die Chance, Gleichgesinnte zu treffen. Alle Kinder können durch dieses breite Spektrum der Integration an Modellen lernen und erleben gesellschaftliche Realität.
Kinder wollen lernen und lernen das, was sie wollen. Die uns anvertrauten Kinder erfahren bei uns weitgehende Freiheiten zu forschen und zu experimentieren. Die ErzieherInnen schaffen durch ihre pädagogische Begleitung „Räume für Kinder“, in denen das für den gesamten Bildungsweg so wichtige selbstorganisierte Lernen ermöglicht wird.
Verschiedene Kurse und Projekte ergänzen als Enrichment die üblichen Bildungsangebote bzw. gehen weit darüber hinaus und bieten somit neue Lerninhalte und Herausforderungen.
Der erste Schritt ist Beobachtung oder Diagnostik. Frühe Diagnostik ist grundsätzlich schwierig. Deshalb erstellen wir bei Kindern im Kindergartenalter nicht die „Diagnose Hochbegabung“, da evtl. von einem Entwicklungsvorsprung ausgegangen werden kann. Die PsychologInnen im CJD wenden bei ihren Untersuchungen grundsätzlich mehrere standardisierte Testverfahren an. Denn es geht nicht um die Ermittlung eines einzigen IQ-Wertes, sondern um die Erstellung einer kognitionspsychologischen Analyse des Denkens, da Denkstrategien der Kinder ebenso wichtig sind wie die Höhe der Intelligenz.
Ebenso wichtig wie eine seriöse Diagnostik ist die regelmäßige Beobachtung durch erfahrene und qualifizierte ErzieherInnen im Förderprozess. Die Erziehungsplanung, deren Ziele sich aus Diagnostik und Beobachtung ergeben, gestalten die Erzieherinnen im Erziehungsteam gemeinsam mit den Eltern. Die Beratung der Eltern spielt eine zentrale Rolle, denn wir verstehen unsere Kindertagesstätten als „Häuser für Familien“.
Intellektuelle Förderung von Hochbegabten
Ganz allgemein ist unter Hochbegabung eine Veranlagung (Disposition) zu außergewöhnlichen Leistungen zu verstehen. Ein Mensch kann in ganz unterschiedlichen Bereichen über besondere Begabungen verfügen: im Sport, in der Musik, in den sozialen Fähigkeiten oder auch im intellektuellen Bereich.
Das CJD hat sich in seinen verschiedenen Einrichtungen auf unterschiedliche Begabungsbereiche spezialisiert und bietet Förderung im intellektuellen, musischen und psychomotorischen (sportlichen) Bereich an.
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Definition einer Hochbegabung im intellektuellen Bereich.
Aus dem Verständnis der Hochbegabung als einer Disposition zu außergewöhnlichen Leistungen ergeben sich verschiedene Aspekte:
1. Unterscheidung zwischen Fähigkeit und Leistung
Seit der Entwicklung von Testverfahren zur Messung der Intelligenz zum Zeitpunkt des vorletzten Jahrhunderts kann und muss zwischen Fähigkeit und Leistung unterschieden werden. Goethe und Gauß wurden als hochbegabt angesehen, weil ihre Leistungen so außergewöhnlich exzellent waren. Und es gibt keinerlei Grund daran zu zweifeln, dass sie hochbegabte Menschen waren. Das Verfahren, Hochbegabung auf Grund von Leistung festzustellen, scheint zunächst nahe liegend. Dennoch zeigt dieses Modell eine Schwäche, der wir gerade im Bereich der Bildung und Erziehung nicht begegnen möchten. Mit Blick auf die Leistung können wir all diejenigen identifizieren, die ihre Begabung in Leistung umsetzen konnten. Aber wir wissen nichts über all jene, die zu solchen Leistungen wie Goethe und Gauß fähig gewesen wären, aber aufgrund anderer Faktoren – mangelnde Förderung, Krankheit, Antriebslosigkeit usw. – dazu nicht kamen. Für jegliche pädagogische Arbeit ist es unabdingbar über die Fähigkeiten informiert zu sein, um dann eine unterstützende Umgebung zu schaffen, damit Kinder und Jugendliche so viel wie möglich ihrer Fähigkeiten mit Freude in gesellschaftliche Leistung umsetzen können.
2. Wissenschaftliche Definition von Hochbegabung
Hochbegabung ist schon im umgangssprachlichen Verständnis gerade nicht die durchschnittliche Begabung, sondern die, die deutlich aus diesem Durchschnitt herausragt. 1920 wurde der sogenannte Intelligenzquotient (IQ) von William Stern, einem Hamburger Psychologen und Wissenschaftler, definiert. Mit dem Intelligenzquotienten wird numerisch ausgedrückt, auf welcher Position ein Mensch in der Verteilung der jeweiligen Altersgruppe in Bezug auf die Intelligenz einzuordnen wäre. Grundlage für diese Einordnung ist die sogenannte Gaußsche Normalverteilungs- oder Glockenkurve.
Sie zeigt die typische Verteilung, die sich in Bezug auf Persönlichkeitsmerkmale wie z.B. Musikalität, Körpergröße oder eben auch Intelligenz vorfindet. Üblicherweise zeigt sich, dass ein Merkmal wie Intelligenz bei den meisten Menschen in mittlerer Stärke ausgeprägt ist und bei wenigen Menschen so gut wie gar nicht oder – am anderen Ende – über die Maßen. Die meisten Menschen befinden sich mit ihrer Merkmalsausprägung im mittleren Bereich der Verteilung. Je weiter die Glockenkurve vom Mittelpunkt entfernt ist, desto weniger Menschen weisen diese Merkmalsausprägung auf. Die Begabung eines Einzelnen kann als Position auf dieser Normalverteilungskurve angegeben werden und mit einem IQ-Wert bzw. dem Prozentrang (PR) angegeben werden (siehe Grafik oben).
Das mittlere Maß der Intelligenz liegt bei einem IQ von 100 (bzw. PR 50). Nach der Multiaxialen Klassifikation der ICD 10 gilt Intelligenz ab einem IQ von 130 (bzw. PR 98) als sehr hoch bzw. weit überdurchschnittlich (intellektuelle Hochbegabung). Man muss dabei berücksichtigen, dass wir es bei der Psyche eines Menschen nicht mit einem exakt bestimmbaren Gegenstand zu tun haben und die Ergebnisse daher nicht mit einer einzelnen Zahl abbildbar sind. Deswegen werden die Ergebnisse oft gemeinsam mit einem Bereich angegeben, in dem der Wert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegt (z. B. mit 95%iger Wahrscheinlichkeit liegt der Intelligenzquotient zwischen 121 und 129). Im Vor- und Grundschulalter kann ein Testergebnis zusätzlich irreführend sein, da nicht auszuschließen ist, dass es sich um einen zeitlich begrenzten Entwicklungsvorsprung des Kindes handelt. Deshalb sollte bei Diagnosen im Vor- und Grundschulbereich auf den Begriff Hochbegabung verzichtet werden.
Dies sind wissenschaftliche Definitionen und Ansätze. Bei der pädagogischen Begleitung und Förderung, insbesondere junger Menschen, muss sorgfältig darauf geachtet werden, welche Konsequenzen aus solchen wissenschaftlichen Definitionen sinnvollerweise gezogen werden können und welche nicht. Vor allem wäre es pädagogisch fahrlässig, Entscheidungen allein von Testwerten abhängig zu machen. Aus diesen Gründen ist es z. B. völlig unsinnig, die Zuweisung zu einem bestimmten Förderprogramm von einem in einem Test erreichten IQ-Wert abhängig zu machen.
3. Moderierende Faktoren
Sofern wir über Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen sprechen, kommt als wesentlicher Aspekt die Erkenntnis hinzu, dass die Fähigkeit eben noch kein Garant für Leistung ist – wer also mathematisch hochbegabt ist, muss nicht automatisch außergewöhnliche Leistungen im Bereich des Mathematikunterrichts erzielen. Gegenwärtige Modelle der Intelligenz berücksichtigen die Tatsache, dass die Umsetzung von Begabung in Leistung wesentlich von sogenannten moderierenden Faktoren abhängig ist. Unterschieden werden zwei Gruppen: Eine umfasst die Einflüsse durch die Umgebung, in der ein Mensch lebt, z.B. bei einem Kind die Frage der sozialen Stellung der Familie, die Schule, existentielle Erfahrungen wie Krankheit usw. In der zweiten Gruppe finden sich die nicht – kognitiven Persönlichkeitsfaktoren. Solche Faktoren sind z. B. Motivation, Ängste, die Fähigkeit, mit Prüfungsstress umzugehen, Arbeitshaltung, Arbeitsstrategien und anderes. Alle diese Faktoren bestimmen in erheblichem Ausmaß die Frage, inwieweit Begabung – also auch Hochbegabung – in Leistung umgesetzt werden kann. Hierdurch wird deutlich, dass eine intellektuelle Hochbegabung keinesfalls hinreichend ist, um erfolgreich in Schule oder Beruf zu sein. Diese Zusammenhänge werden sehr anschaulich im Münchner Hochbegabungsmodell dargestellt.
Für den schulischen und beruflichen Erfolg spielt neben der Begabung auch erworbenes Wissen und Erfahrung eine große Rolle. Je weiter ein junger Mensch in seiner schulischen und beruflichen Bildung aufsteigt, desto bedeutender wird der Faktor „Expertenwissen“ gegenüber dem Faktor „Begabung“ für die Frage, welchen Erfolg dieser Mensch erreichen kann. Es gilt, dass ein Expertenwissen nur aufgebaut werden kann, wenn die moderierenden Faktoren wie z.B. Fleiß oder Motivation gut ausgebildet sind.
4. Von der Diagnostik zur Entwicklung von Förderplänen
Um geeignete Fördermaßnahmen zu entwickeln, muss eine umfassende und differenzierte Diagnostik der verschiedenen Begabungs- und Persönlichkeitsbereiche durchgeführt werden. Im Idealfall misst die Begabungsdiagnostik ausschließlich das intellektuelle Potenzial und filtert die oben genannten moderierenden Faktoren, die die Leistungen in Schule oder Beruf beeinflussen, heraus. In der Realität ist dieser Idealfall allerdings nicht zu erreichen. Die Bestrebungen in der Testdiagnostik richten sich darauf, diesem Idealfall möglichst nahezukommen. Hierfür werden zum einen Bedingungen geschaffen, die möglichst viele äußere moderierende Faktoren ausschalten oder zumindest in ihrem Einflussgrad reduzieren (z. B. reizarme Umgebung, entspannte, motivierende Atmosphäre und anregendes Testmaterial). Zum anderen können die für den jeweiligen Einzelfall wichtigen in der Person liegenden moderierenden Faktoren mit eigenständigen Diagnoseinstrumenten erfasst und in der Ergebnisinterpretation berücksichtigt werden (z. B. standardisierte Verfahren, die Ängstlichkeit, Lern- und Arbeitshaltung oder Konzentrationsvermögen messen). Aus den Ergebnissen der umfangreichen Diagnostik und der zusätzlichen Informationen (z. B. schulische Leistungen, Interessen, Ressourcen, Persönlichkeitsfaktoren und Entwicklungsstand) wird anschließend der individuelle Förderplan entwickelt.
Bei der Entwicklung von Förderplänen ist es uns besonders wichtig, dass diese nicht defizitorientiert ausgerichtet sind. Es darf nicht nur darum gehen, an den Schwächen zu arbeiten. Das Ausbauen der Kompetenzen und Fördern der Stärken sind nicht nur ein gesellschaftliches Anliegen, sondern auch aus individualpsychologischer Sicht ein entscheidender Entwicklungsbaustein. Gerade zu Beginn einer Förderplanung ist sogar der Schwerpunkt auf die Förderung der Stärken zu legen, um die Leistungsmotivation und die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zu stabilisieren, bevor auch die Schwächen oder Defizite in den Fokus der Förderung gestellt werden können.
Leistungssportförderung
Die gängige Definition für Hochleistungssportler erfolgt i.d.R. über die sogenannte Kadereinteilung.
Die Kadereinteilung ist alters- sowie leistungsabhängig und erfolgt nach Buchstaben, A-Kader für die Besten bis D-Kader für den Nachwuchs. In einigen Sportarten wie Schwimmen, Leichtathletik, Wasserspringen, Shorttrack gibt es noch einen nicht offiziellen DE-Kaderstatus. Er bezeichnet diejenigen Sportler, die vom Zeitumfang wie Hochleistungssportler trainieren, jedoch noch keine Einstufung erhalten haben, weil das Einstiegsalter in den Kaderstatus noch nicht erreicht ist. Hier definieren sich die Leistungssportler über die Trainingszeiten und das Talent.
Sportartspezifisch ist die Definition eines Nachwuchssportlers recht unterschiedlich.
Während beispielsweise in Sportarten wie Turnen, Schwimmen, Eiskunstlauf schon 16-Jährige an internationalen Meisterschaften teilnehmen können, ist das Einstiegsalter beim Bobsport erst bei 18 Jahren und demzufolge sind auch 20-jährige Bobsportler noch im Nachwuchsbereich.
In Mannschaftssportarten (Handball, Fußball) gibt es keine Kadernormen. Hier erfolgt ihre Definition über Landesauswahlzugehörigkeit und Trainingsumfang.
Der Weg in die Kader
Die erste Sichtung der Sportler erfolgt in den meisten Sportarten in den Vereinen. Danach steigen die erfolgreichsten Nachwuchssportler in die Landeskader (bis D/C Kader) auf. Hierin sind die besten Sportler eines Jahrgangs in jedem Bundesland erfasst. Die Größe dieses D-Kaders richtet sich wieder nach der jeweiligen Sportart, liegt aber bei ca.10 Athleten pro Bundesland und Sportart.
Die besten Sportler aller Landeskader (D-Kader) steigen in den niedrigsten Bundeskader (C-Kader) auf. C-Kader bestehen (wieder sportartspezifisch) aus ca. 20 Sportlern.
Die Kader darüber (B-Kader/ A-Kader) werden nur über die sportlichen Leistungen definiert. Nachwuchsleistungssportler müssen sich hier mit etablierten Athleten ihrer Sportart messen lassen.
Hierbei ist zur Aufnahme in den A-Kader eine persönliche Platzierung unter den Weltbesten bis Platz 6 bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen Bedingung.
Der Weg in die CJD Christophorusschule
Der Weg in die Kader ist zugleich der Weg in die Leistungssportförderung, über die der jeweilige Sportfachverband entscheidet. Dabei steht natürlich auch die persönliche Entwicklung des Leistungssportlers im Fokus.
Die CJD Christophorusschulen arbeiten mit Sportfachverbänden zusammen und gewährleisten eine optimale schulische Förderung,
- die einerseits den notwendigen Raum für die Ausübung des Leistungssports lässt
- zugleich schulische Abläufe mit eng den Anforderungen des Trainings abstimmt und zusammenführt
- und andererseits die Persönlichkeitsbildung berücksichtigt.
Bei höchsten Anforderungen an körperliche Fitness und sportliche Performance ist Persönlichkeitsbildung im CJD integrierter Teil des Curriculums; junge Menschen, das ist unser Anspruch, gehen in Werthaltungen gefestigt und als junge Menschen gereift auf ihren weiteren Lebensweg.
Zu unseren Schulstandorten, die ausgewiesene Profile im Leistungssport haben, gehören entsprechend immer Internatsangebote im Kontext des CJD Jugenddorfs, in dem dieser Mehrwert an allseitiger Bildung möglich wird.
Voraussetzung für die Aufnahme an der CJD Christophorusschule ist, wie für jeden anderen Schüler auch, die schulische Eignung für die jeweilige Schulform.
Die Förderung musisch talentierter und hochbegabter junger Menschen
Die CJD Jugenddorf-Christophorusschulen haben jeweils eigene Konzepte zur Förderung musischer Begabungen. Diese Konzepte können z. B. über die in den Webseiten der Schulen enthaltenen E-Mail-Adressen erfragt werden. Kurz skizziert wird hier das Konzept der CJD Jugenddorf-Christophorusschule Versmold.
Die Förderung "künstlerisch hochbegabter junger Menschen" erfolgt in der CJD Jugenddorf-Christophorusschule Versmold durch die Einbindung in die "Musischen Klassen – Schwerpunkt Kunst" (Sek I – Klassen 5 bis 10) des CJD Gymnasiums. Hier erlernen die Schülerinnen und Schüler neben dem normalen Unterricht pro Schulhalbjahr eine künstlerische Technik (z. B. Formen der Malerei, Druck, Bildhauerei, Glasgestaltung). Parallel werden die Schülerinnen und Schüler eingebunden in Projekte wie zum Beispiel "Bildende Künste", "Film", "Theater/Kleinkunst", "Tanz" und auch "Ausstellungen". Ein dritter Schwerpunkt liegt in der Begegnung und Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern durch "themenorientiertes begleitetes Arbeiten", "Projekte mit Künstlern" als auch die Übernahme von "Patenschaften". In der Oberstufe (Sek II) vertieft sich der Ansatz durch zusätzliche gezielte individuelle Vorbereitungen auf die Kunstakademie und durch eine enge Zusammenarbeit mit den betreffenden Hochschulen und Kunstakademien.
Die Förderung "musikalisch hochbegabter junger Menschen" erfolgt in der CJD Jugenddorf-Christophorusschule Versmold durch die Einbindung in die "Musischen Klassen – Schwerpunkt Musik" (Sek I – Klassen 5 bis 10) des CJD Gymnasiums. Neben dem Regelunterricht erhalten die Schülerinnen und Schüler zusätzlich eine Stunde Musikunterricht und erlernen entweder ein Musikinstrument ihrer Wahl oder sind in den Vokalbereich eingebunden.
Die Instrumentalisten werden schon frühzeitig über die CJD-Orchesterschule Versmold in kleinere Instrumentalkreise eingebunden, daran schließen sich Vororchester, Kammermusikensembles und Orchester an.
Die stimmlich Veranlagten werden zunächst in den Christophorus-Kinderchor und fortschreitend in den national und international anerkannten Christophorus-Jugendkammerchor Versmold eingebunden. Das vokale Training schließt Stimmbildung mit ein. Die Vertiefung der besonderen Begabung erfolgt durch eine gezielte individuelle Förderung unter Eröffnung der begleiteten Möglichkeiten von Auftritten bei und in Konzerten, Wettbewerbsteilnahmen (z. B. Jugend musiziert, Chorfestivals im In- und Ausland). Spätestens in der Sekundarstufe II erfolgt eine gezielte Beratung der beruflichen Perspektiven, eine Einbindung in andere Musikszenarien (z. B. Orchester, Oper, Musical) sowie eine intensiv begleitete Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen.